Schlagwort: Fotografie
-
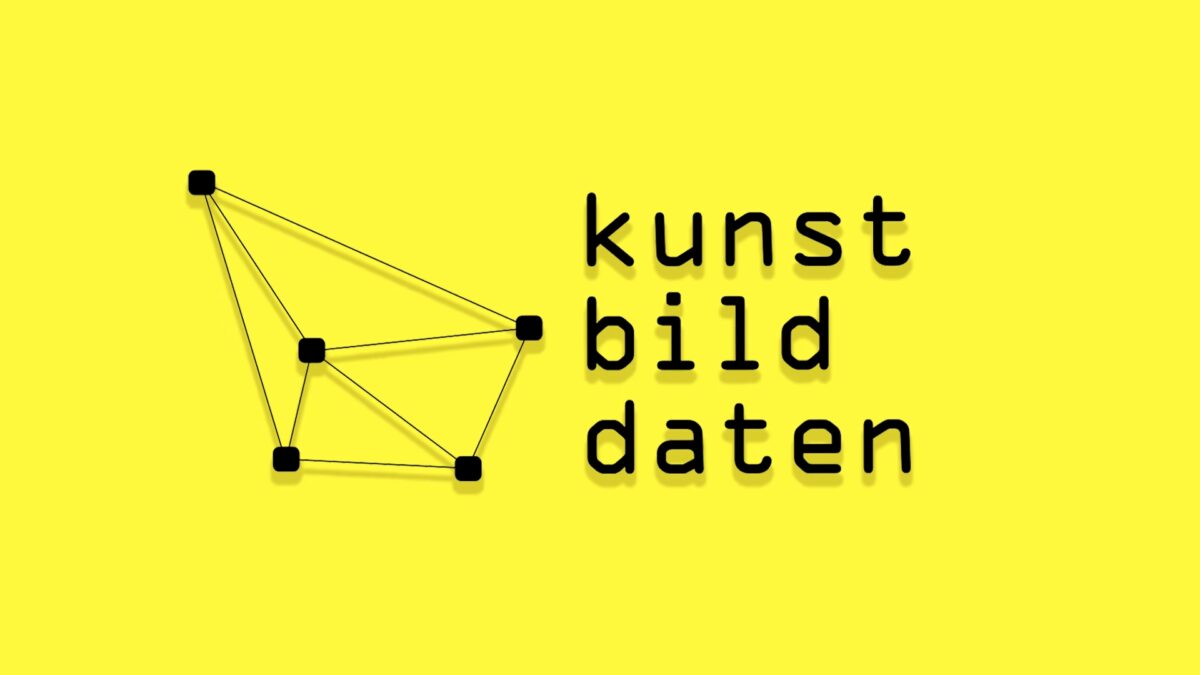
Georg Schelbert: Von den Fotoboxen ins Wissensnetz – noch ein Jahr bei „kunst.bild.daten“
Weiterlesen: Georg Schelbert: Von den Fotoboxen ins Wissensnetz – noch ein Jahr bei „kunst.bild.daten“Einst standen sie ausschließlich in geordneten Fotokästen: Abbildungen von Bauwerken und Kunstwerken, sortiert nach Orten und Namen – wie in einer riesigen analogen Landkarte der Kunst. Jetzt werden sie aus der statischen Struktur in ein vernetztes digitales System überführt, das neue Zusammenhänge sichtbar macht. So wird aus einem Archiv vergangener Epochen ein Werkzeug für die…
-

Jara Lahme über das Oktoberfest in der Münchner Kunstgeschichte
Weiterlesen: Jara Lahme über das Oktoberfest in der Münchner KunstgeschichteIn diesem Jahr, 2025, findet das Oktoberfest zum 190. Mal in München statt. Das weltweit bekannte Volksfest auf der Theresienwiese wird sowohl von den Bayern selbst als auch von den zahlreichen Besuchenden als der Inbegriff bayerischer Kultur verstanden. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass sich in der kürzlich in die Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte überführten…
-
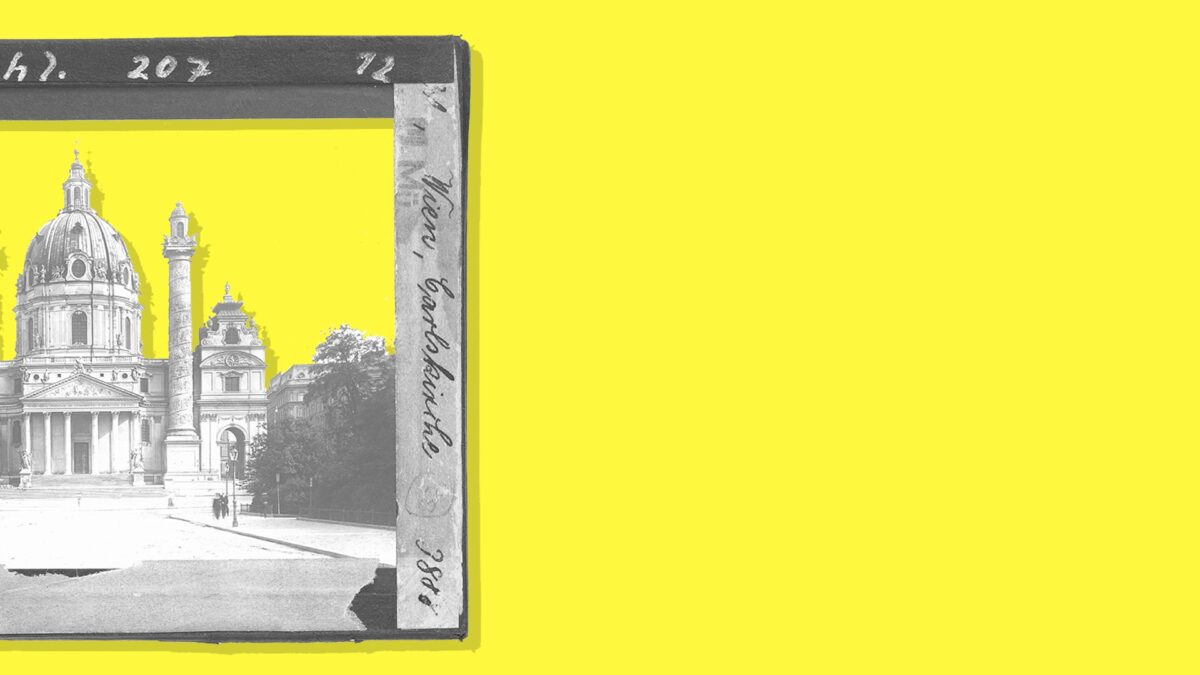
Georg Schelbert über die Dias der Münchner Kunstgeschichte
Weiterlesen: Georg Schelbert über die Dias der Münchner KunstgeschichteTrennung und Wiedersehen Jahrzehntelang waren großformatige Glasdias das visuelle Medium in den Vorlesungen der Kunstgeschichte. Viele Universitätsinstitute wie in Bonn, Berlin, Frankfurt, Halle oder Hamburg besitzen solche Bestände, die bald analog zur Bibliothek Diathek genannt wurden, bis heute. In München hingegen galten sie lange Zeit als verschollen, ja gerieten völlig in Vergessenheit. Jetzt sind sie…
-

Marta Koscielniak über das Vorher-nach?her des Rubens-Gemäldes „Helene Fourment mit ihrem erstgeborenen Sohn Frans“ aus der Alten Pinakothek im Bildarchiv Bruckmann
Weiterlesen: Marta Koscielniak über das Vorher-nach?her des Rubens-Gemäldes „Helene Fourment mit ihrem erstgeborenen Sohn Frans“ aus der Alten Pinakothek im Bildarchiv BruckmannDie Reproduktionsfotografien des Bruckmann Bildarchivs halten historische Zustände von Kunstwerken fest, die teilweise auffallend von dem abweichen, wie wir diese Werke heute kennen. Ein besonders spektakuläres Beispiel zeigt sich in Rubens’ Bildnis seiner zweiten Ehefrau Helene Fourment mit dem gemeinsamen Sohn Frans aus der Alten Pinakothek in München.
-

Franziska Lampe über die Sehnsucht nach Farbe und eine Bruckmann-Fotokampagne am Vesuv
Weiterlesen: Franziska Lampe über die Sehnsucht nach Farbe und eine Bruckmann-Fotokampagne am VesuvAnfang des 20. Jahrhunderts veranlasste der Bruckmann Verlag eine Fotokampagne in den antiken Städten Pompeji, Herculaneum und Stabiae, um dort die erhaltenen Wandmalereien im fotografischen Bild festzuhalten. Konkreter Anlass hierfür waren die von Paul Herrmann ab 1904 veröffentlichten Denkmäler der Malerei des Altertums, in denen Reproduktionen der antiken Bildwerke nebst knapper wissenschaftlicher Einordnung des Archäologen…
-

Annalena Brandt zu Stefan Moses’ Künstler machen Masken
Weiterlesen: Annalena Brandt zu Stefan Moses’ Künstler machen Masken„Niemand möchte erkannt werden, wie er wirklich ist“ wusste Stefan Moses bereits früh in seiner fotografischen Laufbahn (Günter Engelhard, Künstler zeigen ihr wahres Gesicht, in: Art 10, 2001, S. 14–27, hier S. 26). Er bat daher Künstlerkolleg*innen spontan, anschließend an offizielle Porträtsitzungen, innerhalb von fünf Minuten eine Maske zu basteln und für ihn damit zu…
