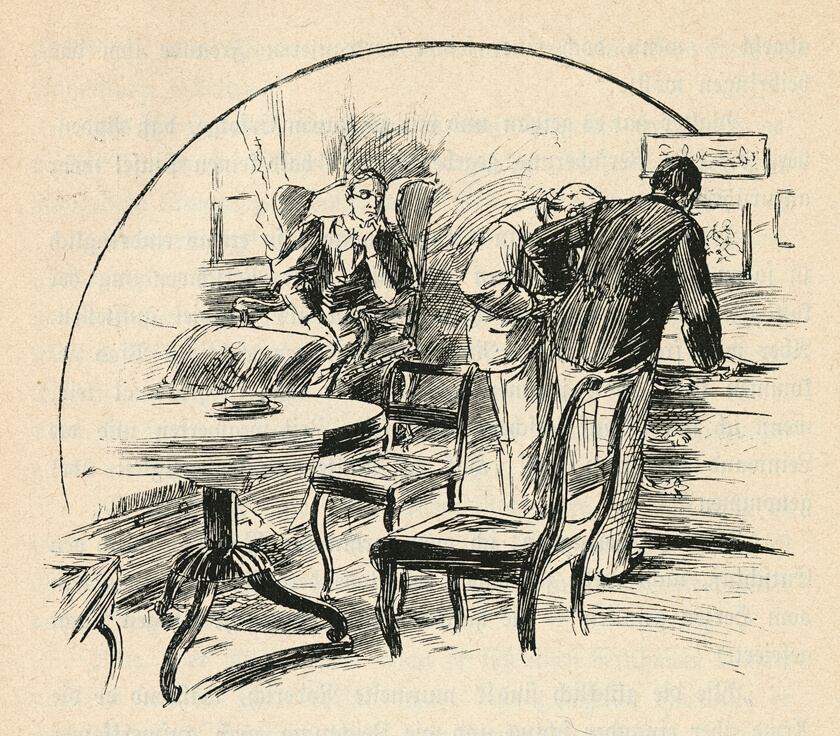Über Künstler und ihre Arbeit liest man in Quellen und der biographischen Literatur. Manchmal gibt es sogar Lebenserinnerungen der Künstler, die oft nicht nur eine Chronik „in eigener Sache“ sind, sondern auch Selbstvergewisserung. Sie dokumentieren häufig, wie sich der Künstler verstanden wissen wollte, der nicht selten damit gesellschaftliche und kulturelle Deutungsmuster und Stereotypen fortschrieb. Diese finden sich auch in literarischen Werken (Roman, Erzählung und Schauspiel), zum Beispiel in biographischen Romanen wie zu Leonardo da Vinci (Dmitri Mereschkowski, Die auferstandenen Götter, 1901), Michelangelo (Irving Stone, The Agony and the Ecstasy, 1961) oder Camille Pissaro (Irving Stone, Depths of Glory, 1985).
Noch deutlicher zeigen das aber seit dem späten 18. Jahrhundert die „Künstlerromane“, in denen fiktive Biographien ein Bild von Leben und Arbeit des Künstlers vermitteln, aber auch viele Romane, in denen Künstler auftreten. Diese Beschreibungen spiegeln die Auffassungen über Kunst als Ergebnis eines schöpferischen Akts zwischen dem im 18. Jahrhundert ausgeprägten Geniekult (mit der Folge der bürgerlichen „Kunstreligion“ im 19. Jahrhundert) und der Vorstellung, dass gerade diese Arbeit dem Künstler Entsagung, Schmerz abverlangt, ja Qual bedeuten kann. Solche Chiffren charakterisieren schon die Inkunabeln der Gattung: Zwar handelt es sich bei Wilhelm Heinses Ardinghello und die glückseeligen Inseln (1787) um – so der Untertitel – Eine Italiänische Geschichte aus dem sechszehnten Jahrhundert, doch schildert der Text die Sehnsucht des Autors nach einer Freiheit, die ihm nur auf einer Insel des Glücks möglich erscheint.
Kunst als Folge der Verinnerlichung prägt dagegen Wilhelm Heinrich Wackenroders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, 1797. In dem Roman seines Freundes Ludwig Tieck (Franz Sternbalds Wanderungen, 1798) ist das ganze Potential des inneren und äußeren Kampfs angedeutet. Einen seiner Akteure ließ Tieck sagen: „Wer sich der Kunst ergibt, muss das, was er als Mensch ist und sein könnte, aufopfern.“ Viele der mit Künstler und Kunst in der Folgezeit verknüpften Fragen und Diskussionen sind hier zur Sprache gebracht: Muss die Kunst einem Zweck dienen oder muss sie sich den Erwartungen verweigern, die den Künstler nur daran hindern könnten, seinen eigentlichen (göttlichen …) Auftrag zu realisieren, nämlich eine Ahnung höherer Werte mitzuteilen? Doch ist genau dieses Vorhaben oft Hemmnis für den durch Selbstzweifel angefochtenen Künstler, eine Gefühlslage, die später der als Maler gescheiterte Gottfried Keller in der 1870 erschienenen zweiten Fassung seines Romans Der Grüne Heinrich mit autobiographischen Zügen (erschienen erstmals 1842) ausführlich beschrieb.
Es gibt eine Fülle von Romanen und erzählender Literatur aus dem 19. und 20. Jahrhundert, in der die verschiedenen Themen und Motive zu Beruf und „Berufung“ des Künstlers und die wechselseitige Abhängigkeit von biographischen Umständen und künstlerischer Produktivität mit großer Bemühung um Einfühlung beschrieben oder karikiert werden, wie etwa von Friedrich Wilhelm von Hackländer (Eugen Stillfried, 1852; Künstlerroman, Stuttgart 1866) oder Otto Julius Bierbaum (Kaktus und andere Künstlergeschichten, 1898): die Einsamkeit des Künstlers während der Arbeit, die Auseinandersetzung zwischen Maler und Porträtierten (Stefan Andres, El Greco malt den Großinquisitor, 1936), der Schmerz, sich vom fertiggestellten Kunstwerk trennen zu müssen (Paul Heyse, Die Dryas, 1890), das Leben im Atelier und außerhalb, der Künstler als gesellschaftlicher Grenzgänger (Henry James, Roderick Hudson, 1875).
Prof. Dr. WOLFGANG AUGUSTYN ist stellvertretender Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und apl. Prof. an der Ludwig-Maximilians-Universität München.