TEIL 3: SCHACH MATT! UND FINITE INCANTATEM
Des Weiteren finden im ersten Film die sogenannten Lewis Chessmen (2. Hälfte 12. Jh.) Benutzung. Harry und Ron spielen mit ihnen zu Beginn der Weihnachtsferien in der Großen Halle von Hogwarts (vgl. u.a. The Lewis Chessmen. New perspectives, ed. by David H Caldwell and Mark A Hall, Edinburgh 2014; James Robinson: The Lewis chessmen, London 2009.).
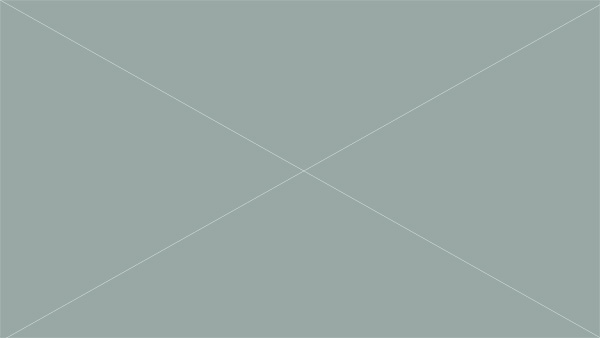
Wenngleich den Schachfiguren ein aktiverer Part zukommt als den Teppichen, führt auch ihre Verwendung zu keiner direkten Veränderung oder Erweiterung der Bedeutung der Szene. Die Strategien, die bereits für die Nutzung anderer Werke der bildenden Kunst angeführt wurden, greifen allerdings auch hier: Der Verweis ermöglicht zum einen die Aktivierung von Wissensbeständen und somit das Erkennen dieser intermedialen Referenz bei den Zuschauer*innen, zum anderen dienen sie der Erzeugung einer mittelalterlich konnotierten magischen Welt. Vor allem aber könnten die Figuren als eine Anspielung darauf verstanden werden, wo genau Hogwarts liegt, obwohl Rowling es in den Büchern nie explizit schreibt. In der Regel jedoch wird die Zauberschule aufgrund zahlreicher Anspielungen und Hinweise in Schottland verortet. Die Landschaftsaufnahmen in den Filmen stützen die Theorie dieser geographischen Zuordnung. Und auch wenn man heute davon ausgeht, dass die Schachfiguren aus Elfenbein von Walrossen und aus Walzähnen, in Norwegen (in der Nähe von Trondheim) entstanden sind, so sind die 78 Spielsteine, die heute im British Museum (67) in London und im National Museum of Scotland (11) in Edinburgh aufbewahrt werden, doch nach ihrem Fundort von 1831 auf der schottischen Hebrideninsel Isle of Lewis benannt.

Die Figuren sind im Verhältnis zu den heute gängigen Steinen sehr groß – der König beispielsweise ist ca. 8 cm hoch – und fast alle Figuren haben menschliche Züge; so gibt es Ritter zu Pferd (anstatt der Springer), konzentriert wirkende Bischöfe (Läufer), nachdenkliche oder melancholische Königinnen, gebieterische Könige und im wahrsten Sinne des Wortes verbissene Berserker (anstatt von Türmen). Dadurch bieten sie sich besonders gut für die Verlebendigung an, die für die Spielsteine im sogenannten Zauberschach erforderlich ist. Hier schlagen sie sich nämlich tatsächlich gegenseitig kurz und klein.
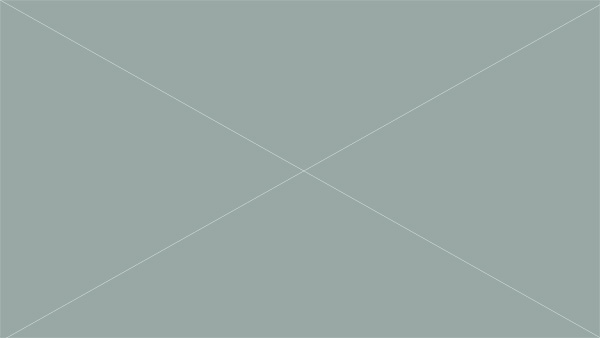
Dadurch, dass in dem Harry Potter-Film die Steine eines Spielers rot eingefärbt sind, wird zudem ersichtlich, dass sich die Szenenbildnerinnen mit der Forschung auseinandersetzt haben müssen und die Wahl explizit dieser Figuren nicht gänzlich willkürlich war: Denn auf einigen Figuren sind tatsächlich Rückstände von roten Pigmenten nachzuweisen.
FINITE INCANTATEM
Dieses intermediale Verweissystem der Filme, das sich vornehmlich Gegenständen der Kunstgeschichtsschreibung bedient, wurde von zahlreichen Wissenschaftler*innen anderer Fachbereiche bereits bemerkt und besprochen, nur die Kunstgeschichte selbst und/oder ihr verwandte Disziplinen wie die Bildwissenschaften haben sich dazu noch nicht weiter geäußert (Zu den sich bewegenden und sprechenden Bildern bei Harry Potter ist allerdings ein Aufsatz von Caroline de Launay erschienen. Vgl. Caroline de Launay: L’animation des portraits dans Harry Potter Théorie et étude de cas, in: textimage 3, 2011, 1–32.). Dabei wäre es gerade ihre Aufgabe, die neuen semantischen Zusammenhänge dieser Objekte zu deuten. Denn oft wird in der vorhandenen Forschungsliteratur bei Nennung der verschiedenen Werke nicht einmal auf die entsprechende kunsthistorische Fachliteratur verwiesen. Vielleicht fühlt sich ja nun die/der ein oder andere dazu berufen, unter diesem Vorwand, die Filme bei der nächsten Gelegenheit ganz ausführlich zu studieren.
ANNA LENA FRANK, M.A. war 2018 bis 2019 Stipendiatin der Freien und Hansestadt Hamburg am ZI. Derzeit ist sie Stipendiatin der Gerda Henkel Stiftung mit einem Dissertationsprojekt zur Intermedialität der Epitaphien aus der Zeit der Konfessionalisierung (ca. 1530 bis 1630) in den von Johannes Bugenhagen reformierten Territorien Hamburg, Lübeck, Schleswig und Holstein.

