Kategorie: MAIA
-
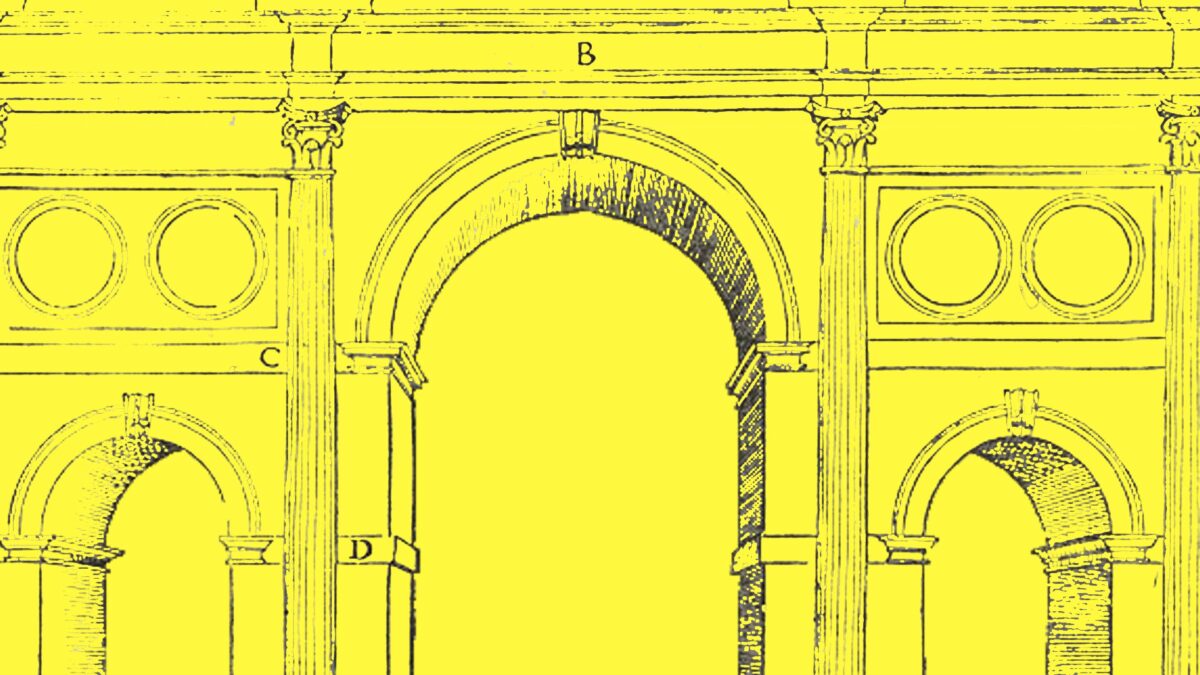
Lust auf Verschlusssachen? Ann-Kathrin Fischer und Martin Stahl über besondere Bücher aus dem Bibliotheksbestand des ZI
Weiterlesen: Lust auf Verschlusssachen? Ann-Kathrin Fischer und Martin Stahl über besondere Bücher aus dem Bibliotheksbestand des ZIUnter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ fand am 4. April 2025 in München zum ersten Mal die „Nacht der Bibliotheken“ statt, an der sich auch das Zentralinstitut für Kunstgeschichte mit seiner Bibliothek beteiligte. Ann-Kathrin Fischer, Kunsthistorikerin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Direktion am ZI, und Martin Stahl, Bibliothekar und verantwortlich für die Benutzungsdienste unserer Bibliothek,…
-

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.
Weiterlesen: Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.Die Ausstellung Travelling Back, gezeigt zwischen Februar und April 2024 am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, richtete einen kritischen Blick auf die Erzählungen und Sammlungen, welche die bayerischen Wissenschaftler Johann Baptist von Spix (1781–1826) und Carl Friedrich Philipp von Martius (1794–1868) im 19. Jahrhundert aus Brasilien mitbrachten.
-

Hannah Rathschlag über die Künstlerin und Literatin Mary Eliza Haweis (1848–1898) und (guten) Kunstgeschmack im Viktorianischen Zeitalter in England
Weiterlesen: Hannah Rathschlag über die Künstlerin und Literatin Mary Eliza Haweis (1848–1898) und (guten) Kunstgeschmack im Viktorianischen Zeitalter in England„Every style has a beauty and interest of its own; […] is worthy attention, and is sure to teach us something”. Diese Aussage formulierte Mary Eliza Haweis in dem Vorwort ihres Buches Beautiful Houses. Being a Description of certain well-known Artistic Houses (1882), wodurch ihre reflektierte und präzise Beobachtungsgabe widergespiegelt wird.
-
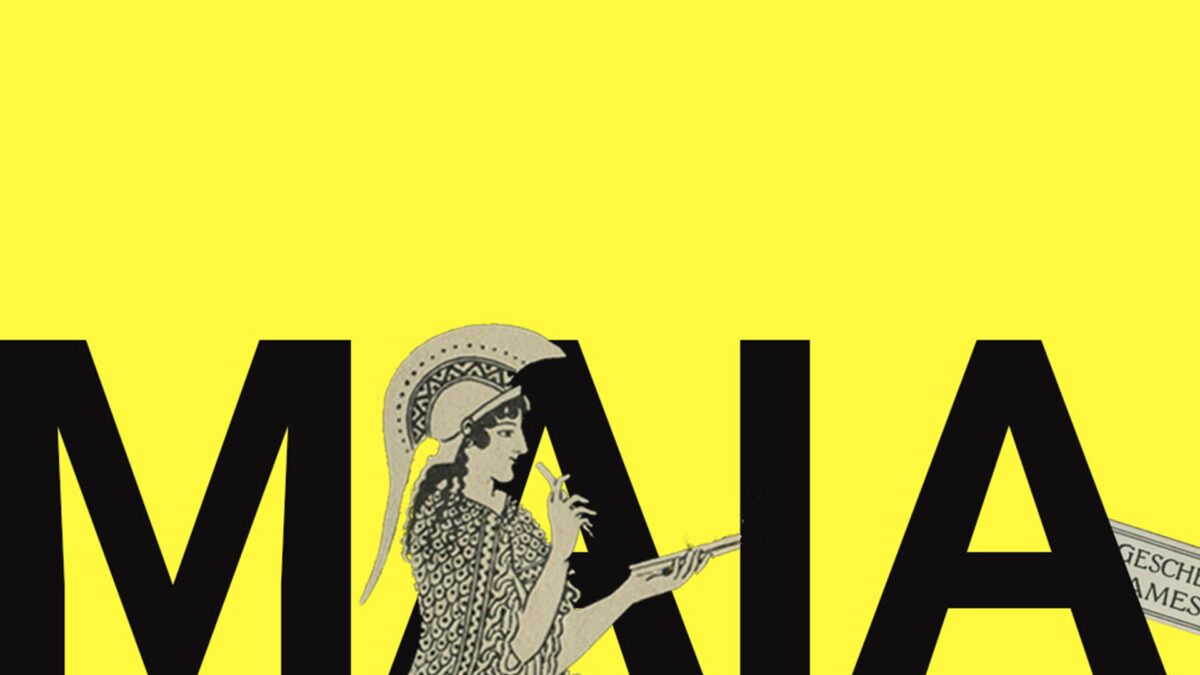
Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor
Weiterlesen: Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vorViktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im Original mit englischer Übersetzung herausgibt.…
-
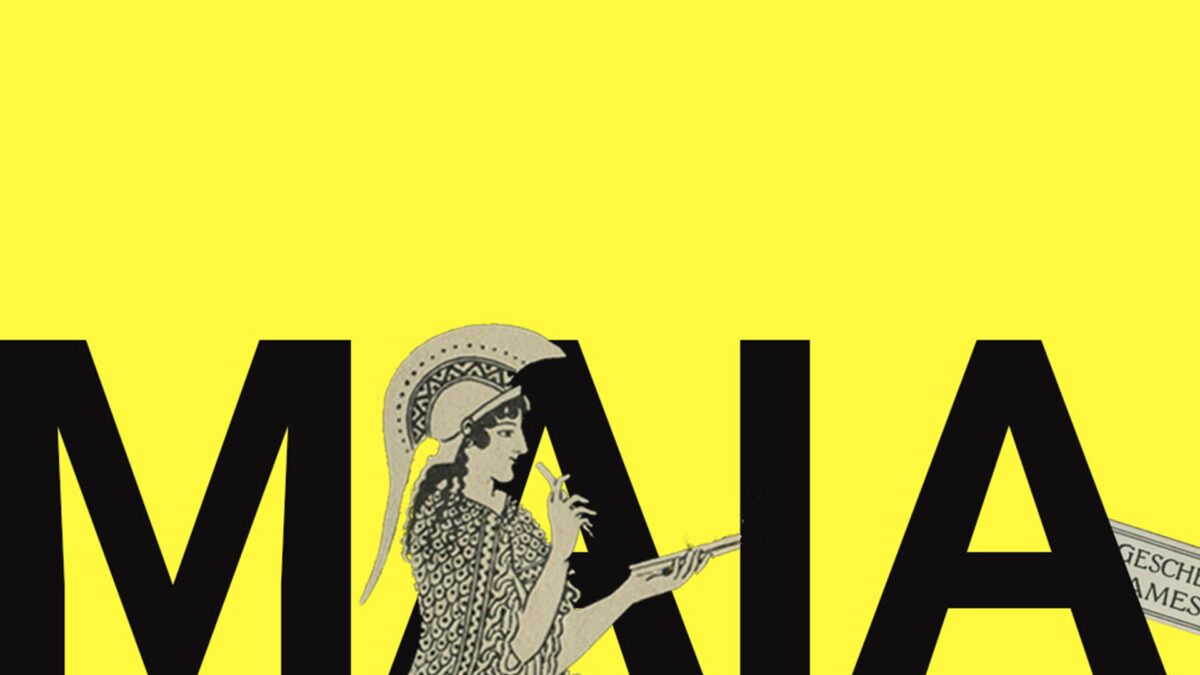
Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor
Weiterlesen: Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vorViktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen Nationalmuseums und des Museums fünf…
-

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor
Weiterlesen: Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vorElisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik | Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte.
