Autor: ZI
-

Ann-Kathrin Fischer über die schreibenden Töchter der Familie Patin
Weiterlesen: Ann-Kathrin Fischer über die schreibenden Töchter der Familie PatinMit aufmerksam-interessiertem Blick wendet sich die achtzehnjährige Carla Caterina (1666–1744) ihrem Vater Charles Patin (1633–1693) im Gespräch zu. Daneben sitzt ihre Mutter Madeleine (1642–1722), selbst Schriftstellerin, die in der linken Hand ein Medaillonbildnis ihres Schwiegervaters Guy Patin hält. Rechts davon ist die ältere, neunzehnjährige Schwester Gabriella Carla (1665–1751) platziert. Noël Jouvenet (1650–1698) hat dieses Familienbildnis…
-

Russische Creme am Friedensengel: Der Central Collecting Point bei Johannes Mario Simmel
Weiterlesen: Russische Creme am Friedensengel: Der Central Collecting Point bei Johannes Mario SimmelIRIS LAUTERBACH 1960 erschien in Zürich der Roman Es muß nicht immer Kaviar sein des österreichischen Schriftstellers Johannes Mario Simmel (1924–2009). Der Untertitel „Die tolldreisten Abenteuer und auserlesenen Kochrezepte des Geheimagenten wider Willen Thomas Lieven“ spielt auf Honoré de Balzacs Contes drôlatiques an und weckt bei der Leserin, beim Leser die Erwartung anzüglicher Schilderungen unterhaltsamer…
-
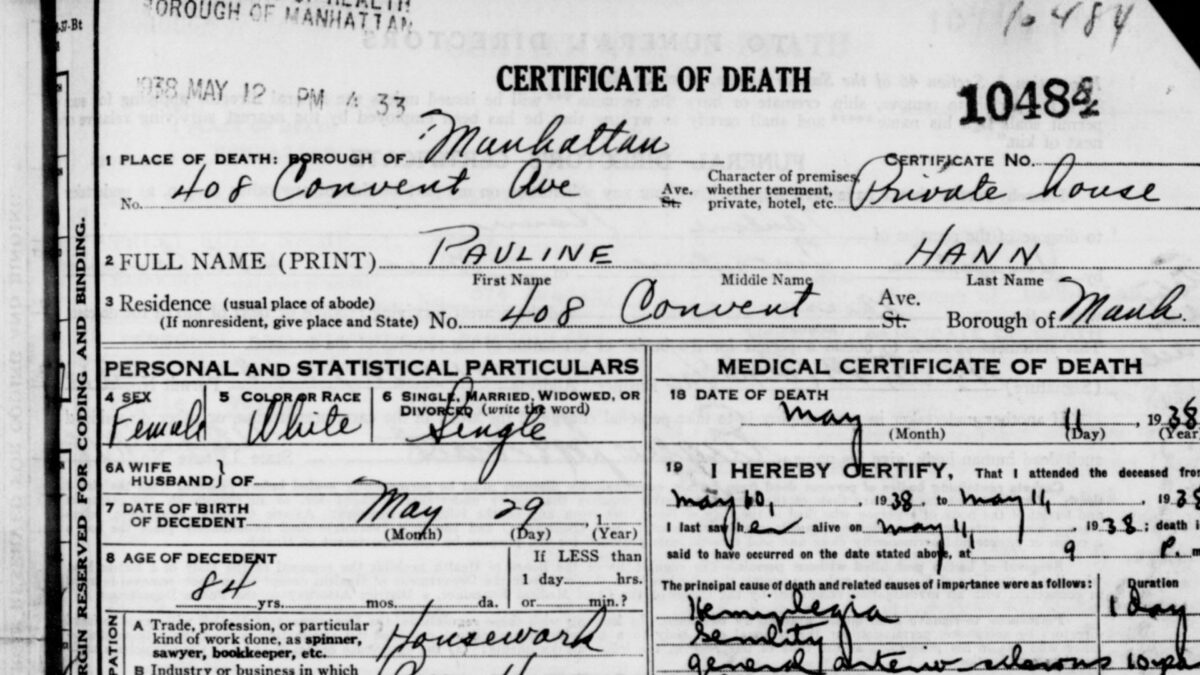
Annalena Brandt über Kunst für Alle… aber nicht von allen
Weiterlesen: Annalena Brandt über Kunst für Alle… aber nicht von allenNachdem es zu Beginn des 20. Jahrhunderts so aussah, als ob schreibende Frauen in der Kunstwelt endlich (wenigstens etwas) anerkannt wurden, mussten ab 1907 zumindest in der Kunstzeitschrift Kunst für Alle (KfA) erhebliche Rückschläge hingenommen werden. Waren ab dem 2. Jahrgang 1887/88 insgesamt 14 Schriftstellerinnen mit mehr als 60 Artikeln vertreten, lässt sich nach dem…
-

Eine kleine Technikgeschichte des ZI
Weiterlesen: Eine kleine Technikgeschichte des ZIEVA BLÜML „Das ZM verfügt über einen großen Leitz Projektor und einen Leitz-Parvo11-Bildwerfer für Kleinformate. Die Anschaffung eines Lesegerätes für Mikrofilm ist vorgesehen“ [Jahresbericht ZI 1949-50, S. 8]. Technik ist schon seit der Gründung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, damals noch ZM, ein Thema: so bedienten sich die Kunsthistoriker*innen am ZM aktueller Technologien, um die Grundlagen…
-

Hanna Lehner zu Félicie d’Ayzac: Eine Frau auf dem Dach von Saint-Denis
Weiterlesen: Hanna Lehner zu Félicie d’Ayzac: Eine Frau auf dem Dach von Saint-DenisDrinnen wirkt es beengt, es ist dunkel (Abb. 1). Die Wiege zu Füßen, der Rosenkranz in der Hand und die Marienstatue an der Wand signalisieren den konventionell begründeten ‚Zuständigkeitsbereich‘ der sitzenden jungen Frau, die sehnsüchtig durch das Fenster nach draußen blickt. Dort hingegen ist alles licht und luftig, in der Ferne zeichnet sich angeschnitten die…
-

„…aus dem Aluminium ihrer Todesflügel hätte man die Kochtöpfe herstellen können…“ Ursula Ströbele über Juliane Roh zwischen Kunstgeschichte und politisch-feministischem Engagement
Weiterlesen: „…aus dem Aluminium ihrer Todesflügel hätte man die Kochtöpfe herstellen können…“ Ursula Ströbele über Juliane Roh zwischen Kunstgeschichte und politisch-feministischem EngagementTeil 2 Juliane Roh (Abb. 3) prangert in ihren Texten wiederholt die Zwangsrekrutierung der Frauen während des Krieges an, die „zum Arbeitssklaven männlich militärischer Interessen“ erniedrigt wurden bei gleichzeitiger Instrumentalisierung im Zuge der nationalsozialistischen Fortpflanzungspolitik. „Alles, was ihr der Gleichberechtigungskampf mühsam erworben hatte […], hat ihr der Staat wieder genommen.“ (Der Krieg und die Frauen,…
